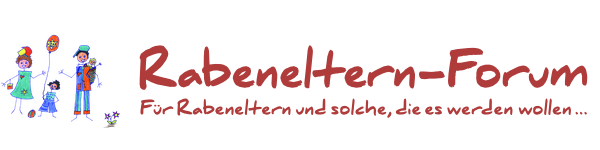Für mich war Wickie immer ein Mädchen und nur wegen des Namens, den ich nur für Mädchen kannte (als Abkürzung von Victoria) allerdings habe ich die Serie nicht wirklich gesehen, bzw. wenn war es mir egal, welches geschlecht.
Beiträge von Stadtkaninchen
Liebe interessierte Neu-Rabeneltern,
wenn Ihr Euch für das Forum registrieren möchtet, schickt uns bitte eine Mail an kontakt@rabeneltern.org mit eurem Wunschnickname.
Auch bei Fragen erreicht ihr uns unter der obigen Mail-Adresse.
Herzliche Grüße
das Team von Rabeneltern.org
wenn Ihr Euch für das Forum registrieren möchtet, schickt uns bitte eine Mail an kontakt@rabeneltern.org mit eurem Wunschnickname.
Auch bei Fragen erreicht ihr uns unter der obigen Mail-Adresse.
Herzliche Grüße
das Team von Rabeneltern.org
-
-
Als langjährige Stadtmieterin mit anonymen Briefen im Briefkasten wegen zu lauter Kleinkinder hast Du mein volles Mitgefühl - Katzen hin oder her, das Benehmen ist voll ätzend und auch unangenehm aggressiv. Versuche das zu vergessen und ärgere Dich nicht darüber
 Ich hoffe die Kätzchen gewöhnen sich an die Wohnung.
Ich hoffe die Kätzchen gewöhnen sich an die Wohnung. -
Ich hatte das auch ganz fies und extrem schmerzhaft- bei mir besonders an den Händen. Es sah aber nicht so heftig aus, wie auf dem Bild, deshalb würde ich in jedem Fall dazu raten zum Arzt zu gehen. Gute Besserung

-
Ich kann auch nur von mir berichten und denke, das hängt wirklich ganz stark von Mama und Kind ab

Ich habe auch beim Großen probiert mit nur noch Nachts stillen oder nur noch am Morgen - und es hat überhaupt nicht funktioniert. Irgendwann hatte ich den Punkt erreicht, dass ich absolut nicht mehr mochte - da war er ca. 2 Jahre und 3 Monate und immer noch Stilljunkie, das heißt Nachts gerne so drei, vier Mal und tagsüber auch gerne öfter - da habe ich von jetzt auf gleich einfach aufgehört. Ich habe ihm gesagt, dass die Milch alles ist, - drei, vier tage war das schwer, - er war traurig, ich irgendwie auch - und dann war alles wieder gut. (Er hat aber nachts trotzdem noch schlecht geschlafen

 )
)Bei der Kleinen habe ich das dann genauso gemacht, als sie ca. 2 3/4 war - das war aber grundsätzlich nicht so schweirig, da sie viel weniger gestillt hat und nachts geschlafen hat - da habe ich tatsächlich aufgehört, weil es sich einfach richtig für mich anfühlte, der "Leidensdruck" war aber geringer.
Wenn es sich für Dich richtig anfühlt und mit reduzieren schwierig ist, würde ich daher zum Abstillen raten, wenn sich das für Dich richtig anfühlt

-
In dem wikipedia Artikel über Tollwut wird berichtet, dass Tollwut schon in der Antike in Griechenland beschrieben wurde, in Deutschland und Österreich gab es verschiedene Mediziner, die zu dem Thema (erwähnt werden das 18. und 19. Jahrhundert) geforscht haben - den Impfstoff entdeckte 1885 der französische Mediziner Louis Pasteur (das stand woanders) - die Legenden von Werwölfen kommen wohl von der Tollwut- also nein, die Tollwut gab es schon vor dem 2. WK in Europa- und somit auch in Deutschland.
-
Ja mich hat das auch genervt, - ich war auch ständig schuld, weil ich ihm die Hände gegeben habe oder weil ich ihn getragen habe. Ich war auch echt froh, dass es vor dem 2. Geburtstag noch geklappt hat, - bei uns gab es auch kein anderes Kind im Umfeld, das so spät gelaufen ist. Immerhin hatte ich meine Schwester als beruhigendes Beispiel.
Ich denke auch, dass man in Ruhe einige Sachen ausschließen sollte - das habt ihr ja auch gemacht - wenn das kind gesund ist, wird es dann eben auch laufen lernen

Läuft er denn an den Händen?
-
Unser Sohn lief mit 22 od. 23 Monaten frei - vorher nur an beiden Händen- oder halt in sehr schnellem Tempo krabbelnd. Auffälligkeiten gab es keine, außer dass er vier Wochen vor Termin geboren wurde. Wir haben nichts gemacht- allerdings wollte der KiA Ergotherapie, wenn er mit 24 Monaten nicht frei gelaufen wäre. Unser Sohn war seither immer entwicklungsgerecht und ist jetzt auch ein guter Schüler und spielt begeistert Fußball

Meine Schwester lief auch erst mit zwei Jahren frei (zum Kummer meiner Mama) - ich glaube, das gibt es einfach. Klar, muss man schauen, ob es medizinische Gründe gibt, aber wenn nicht, darf man sich entspannen

Unsere Tochter lief übrigens mit zwölf Monaten frei - sie ist nur ganz kurz gekrabbelt und längst nicht so schnell und ausdauernd wie der Große

-
Ich habe auch keine Lösung - vielleicht beruhigt es dich, dass ich als Kind auch sehr gerne mit Kuscheltieren gespielt habe und auch gesamt mehr als 100 davon hatte - ich besitze auch heute noch vier davon, die mittlerweile meine Tochter hat und trotzdem eine ,normale‘ Erwachsene geworden bin

Versuch nochmal darüber nachzudenken, was genau dich daran stört, an sich schadet das ja nicht, oder?
-
ach und zu spack - also enger Kleidung - gehört auch noch der Spacko - ein männlicher Jugendlicher von schlichtem Gemüt
-
ein Schlawiner ist bei uns ein Gauner - man kann sich auch dirchschlawinern im Sinne von mogeln,

-
wenn man etwas gemütlich macht bzw. es gemütlich ist, dann ist es muschepupu,
knülle heißt bei uns auch müde,
pekig heißt so etwas wie klebrig oder verdreckt,
mittenmang kenne ich auch - ‚mang’ als solo wort nicht
musik von einer band ist eine Mucke, ein unangenehmer Mensch ist ein Knilch,
wer sich aufregt oder etwas nicht mag, „bekommt“ davon „Schwämmchen“
jemand der ausgeglichen ist, ist wohl temperiert
jemand der geizig oder undankbar ist, benimmt sich schoffelig
-
Darüber bin ich heute in der Zeitung gestolpert und fand das so gut, dass ich es hier mal reinstellen wollte
 Das ist eine Petition, die sich für eine gerechtere Besteuerung von Tampons und Binden usw. einsetzt : https://www.change.org/p/die-p…zinger-bmfsfj?signed=true
Das ist eine Petition, die sich für eine gerechtere Besteuerung von Tampons und Binden usw. einsetzt : https://www.change.org/p/die-p…zinger-bmfsfj?signed=true -
Bryn, es handelt sich nicht um Sachbeschädigung gem. § 300 StGB da die Sache durch den Aufkleber nicht beschädigt oder zerstört wird. Beschädigung bietet zwar einen gewissen Ermessensspielraum, aber da ein Aufkleber - und auch ein zweiter Aufkleber darüber - relativ leicht entfernt werden kann, also ohne erheblichen Aufwand - würde ich eine Beschädigung ausschließen. (Juristisch heißt das dann, es habe an der Sache durch das Bemalen oder Anbringen des Aufklebers keine Substanzverletzung stattgefunden, gilt übrigens sogar auch beim Kleben von Plakaten mit wasserlöslichem Kleber). Zudem wäre ja auch der Inhalt der Aufkleber oder der geänderten Parole nicht strafrechtlich relevant.
Strafrechtlich dürfte Euer Vorhaben nicht verfolgt werden können. (es gab allerdings mal den Versuch, so etwas als Bildung einer kriminellen Vereinigung zu bestrafen, das wurde aber vom Gericht kassiert) Wen es interessiert: https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/3/16/3-86-16.pdf
Zivilrechtlich hast du aber das Eigentum der Kommune ohne Einverständnis beeinträchtigt und die Kommune könnte dich einerseits auf Unterlassen verklagen sowie eventuelle Reinigungskosten fordern, - im Zweifel ist das eher als unwahrscheinlich einzuschätzen und dürfte sich vom Risiko in Grenzen halten.
-
Bei uns ist das insofern auch kein Thema, da es mein Kind nicht stört, daher gebe ich der Lehrerin auch keine Rückmeldung. Ich finde es trotzdem sinnbefreit - aus den genannten Gründen

-
Trin, bei uns wird Antolin in die Benotung mit einbezogen, wenn das Kind Kippe steht.
-
Ich denke, man kann Antolin ,austricksen' indem man andere die Fragen beantworten lässt, das Buch gar nicht liest, sondern sich eine Zusammenfassung besorgt oder auch den Film anschaut, sofern eine Verfilmung existiert.
-
Iverna, hmm, darüber muss ich mal nachdenken, aber dass es nun viele Leser gibt, die den Inhalt einer Geschichte ,falsch' verstehen, dieses Problem hab ich bisher eher nicht gesehen. Zumal Kinderbücher auch zumeist eine recht klare Erzählstruktur und relativ eindeutige Botschaft haben. Ansonsten würde ich sagen, gibt ein Schriftsteller eine Geschichte auch ein Stück weit aus der Hand, so dass es zumeist durchaus verschiedene Möglichkeiten gibt, sie ,richtig' zu lesen

-
Ich finde, dass es einen großen Unterschied macht, ob eine Klasse gemeinsam ein Buch liest und dazu arbeitet und darüber diskutiert - denn auch wenn man ein Buch doof findet, profitiert man doch normalerweise von dem Austausch, zudem reflektiert man das Gelesene und lernt zudem, sich über Texte auszutauschen - oder ob man alleine im Kämmerlein einen Fragenkatalog abarbeitet. Das halte ich nämlich für normale Leser tatsächlich für überflüssig und bezweifle einfach, dass Kinder, die nicht lesen, sich nun durch Antolin anregen lassen. Einmal abgesehen davon, dass man das System relativ leicht austricksen kann.
-
Ich bin da ganz bei Dir
 Ich finde das System auch merkwürdig - und verstehe nicht, wozu Antolin gut sein soll und kann mir auch nicht vorstellen, dass das jemanden zum Lesen animiert - ich selber lese auch gerne und viel und schon immer, aber warum man von einer kurzen und einseitigen Reflektion des Inhalts von Büchern als Leser profitieren soll, erschließt sich mir auch nicht...
Ich finde das System auch merkwürdig - und verstehe nicht, wozu Antolin gut sein soll und kann mir auch nicht vorstellen, dass das jemanden zum Lesen animiert - ich selber lese auch gerne und viel und schon immer, aber warum man von einer kurzen und einseitigen Reflektion des Inhalts von Büchern als Leser profitieren soll, erschließt sich mir auch nicht... -
Ich meine, dass die für Euch zuständige Oberfinanzdirektion Auskunft erteilt, das dauert aber auch einen Moment. Ansonsten kann ein Anwalt, insbesondere einer der auch Notar ist, Euch beraten - grds. könnt ihr kurzfristig jeden Notar bitten, zu prüfen, ob die Übernahme der Kosten der Vereinssatzung entspricht - fragt mal vorher, wie viel die Beantwortung dieser Frage kostet im Regelfall dürften das 30 Euro sein, max. 50. Möglicherweise macht das der Notar, der den Verein damals bei der Eintragung beraten hat, sogar kostenlos.